Hopfen und Malz
Diese Karte zeigt uns die streitenden Reiche des Bieres, des Weines und des Geistigen. Die meisten Länder fallen in die Domänen, die man erwarten würde, aber es gibt auch ein paar interessante Ausreißer – hätten Sie gedacht, dass Spanien überwiegend dem Bier huldigt, und Schweden dem Wein?[1]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcohol_belts_of_Europe_(actual_consumption_in_2016).svg
Mit dem vierfachen Konsum an Bier im Vergleich zum Wein ist Österreich heute ein treuer Vasall des Hopfens. Aber zumindest Tirol war einst der Traube untertan. Um die Bevölkerung des gebirgigen Landes mit Getreide zu versorgen war man seit jeher auf Importe angewiesen. Somit war die Vorrausetzung für das Brauen von Bier ungünstig, da es mit dem Brot um das Korn streiten musste. Hinzu kam, dass die sonnigen Hänge Südtirols den Winzer mit ausreichend Trauben beliefern konnten. Noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts gab es im nördlichen Landesteil nur 28 Bierwirte, die einer Übermacht von 578 weinausschenkenden Berufskollegen gegenüberstanden.
Klöster waren sowohl Zentren der Bier- als auch der Weinherstellung. So überrascht es nicht, dass auch auf dem Grund der heutigen Stadt Innsbruck das erste Brauhaus 1305 im Urbar des Stifts Wilten auftaucht. In Tirol wurde vor allem dunkles Bier gebraut, sein hellerer Cousin fand erst mit Ferdinand II. (1529–1595) Verbreitung. Dieser war zuvor Statthalter seines Vaters in Böhmen gewesen und brachte durch seinen Hofstaat den Absatzmarkt dafür mit.
1642 richtete Kanzler Wilhelm Biener in Büchsenhausen eine Brauerei ein, die sich bis in die 1920er hielt.
(Signatur Ph-23438)
[1] Die Statistik richtet sich allerdings nach dem Konsum von reinem Alkohol pro Getränk – man kann also durchaus mehr Bier als Wein trinken und dennoch nach dieser Darstellung zu den Weintrinkern gehören.

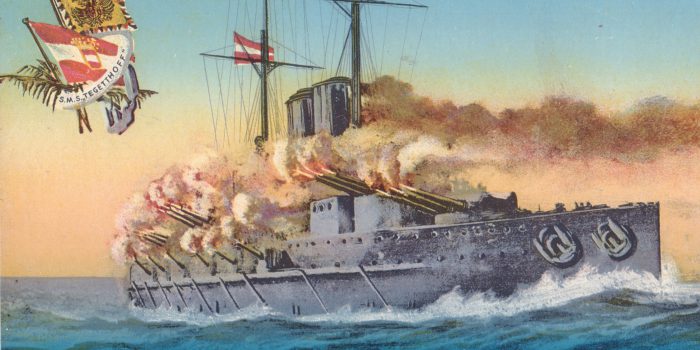


Das Schoss Büchsenhausen hat wahrlich eine sehr bewegte Geschichte. Von der Gießerei Löffler einer Badeanstalt bis hin zur Bierbrauerei und einer Filmproduktion wo der Film „Traumstraße der Alpen“ entstand, beinhaltete das ehrwürdige Gemäuer.
Der Abgebildete Bierdeckel eine wahre Rarität!
Der Eiskeller vom Schloss diente nicht nur der Brauerei als Eisquelle, sondern belieferte auch zahlreiche Eiskästen in der Stadt, vor allem in Gaststätten.
Die Brauereien rund um Innsbruck holten sich das Eis mit Pferdefuhrwerken vom Amraser See. Dort gab es den Beruf des „Eisschneider“
Da zu dieser Zeit Hauptsächglich Obergärige Biere gebraut wurden, diente das Eis nur zur Lagerung von diesen.
Büchsenhausen dürfte einen sog. Eisgalgen in Verwendung gehabt haben.
Eisgalegen ist ein Gestell wo Wasser herunter rieseltt und gefriert so dass man das Eis gewinnen konnte.
Der Bierdeckel lässt vermuten, dass die Schlossbrauerei Büchsenhausen ihren Hopfen aus einem der größten Hopfenanbaugebiete der k. u. k. Monarchie, aus der Gegend um Saaz in Böhmen bezogen hat. Erstaunlich, wie viele Hopfenhandelshäuser, Hopfendarren, Hopfenlager, etc. es in dieser Region gegeben hat:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Industriedenkmale_in_%C5%BDatec
Mit ihrer Vermutung liegen Sie richtig Frau Stolz.Doch der Name am Deckel „Franz Erben“ dürfte eher der Hersteller des Bierdeckels sein. Der Saazer Aromahopfen ist heute noch gefragt. In Deutschland liegt das größte Hopfenanbaugebiet in der Hallertau bei Spalt und in der Gegend rund um Lindau am Bodensee. Doch auch wir haben Hopfenfelder in der Steiermark wie in Gamlitz und Leutschach.
Übrigens – der Hopfen ist die teuerste Zutat beim Bierbrauen.
Das war mir schon klar, Herr Schneider 😉 Allerdings hat der Hinweis auf Saaz (Zatek) mein Interesse auf die Verbindung einer Innsbrucker Brauerei zu dieser böhmischen Stadt geweckt. Ich wusste nicht, dass dort der Hopfenanbau so präsent war/ist und überlegte, warum Büchsenhausen seine Bierdeckel nicht von einem näher gelegenen Lieferanten bezog. Einen Kartonagenhersteller Franz Erben habe ich nicht gefunden, wohl aber diesen Namen auf einem Gedenkstein für Gefallene des 1. WKs. (Erben Franz, geb. 1870, gest. 1918)
Liebe Frau Stolz – da sich beim Namen Franz Erben der letzte Buchstabe I. ? nicht genau entziffern lässt, könnte es sich auch um ein anderes SAAZ in der k.&k. Monarchie handeln so wie es bei uns im Lande etliche Feistritze gibt.
Schön langsam wird der Büchsenhausener Bierfilz zur unendlichen Geschichte…………..
P.S. Interessant wäre auch die Rückseite von dem Bierdeckel falls es eine gibt
Ich bin mir ziemlich sicher, Herr Schneider, dass „Saaz i. B.“ für „Saaz in Böhmen“ steht. Aber vielleicht erbarmt sich Herr Permann ja unser und wir bekommen noch eine besser lesbare Rückseite dieses Bierdeckels zu sehen – zwecks Aufklärung des Büchsenhausener Bierfilzes.
OK Frau Stolz das sollte ein B sein dann ist ja die Herstellug geklärt. Danke für ihre Mühe.