Wild Wild East
Ein Blick auf die Freundsbergstraße. Zu sehen sind mehrere Wohnblöcke, wie sie dort in den frühen 1960er Jahren, in Massen aus dem Boden schossen. Sie sollten schnell und effizient modernen Wohnraum schaffen. Wohnraum für die, die im engen, „alten“ Innsbruck keinen Platz mehr hatten. Aber auch für die zahlreichen Zugezogenen aus der Nachkriegszeit. Es ist die Entstehung der Reichenau. Einem Stadtteil der bis heute einen schlechten Ruf als ein fast schon gefährlicher, verwilderter Außenbezirk genießt.
Selbst dort aufgewachsen, beobachte und höre ich regelmäßig Vorurteile und Schauergeschichten über dieses „Rattlerviertel“. Bei einem Bewerbungsgespräch ist es nicht gerade vorteilhaft, wenn die Adresse etwa Klappholz- oder Radetzkystraße lautet. Auch wenn das architektonische Erscheinungsbild des Viertels in den letzten Jahren durch stadtplanerische Maßnahmen etwas aufpoliert wurde, haben sich die Worte, die über die Reichenau gewechselt werden, kaum verändert. Doch wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass wir Reichenauer uns selbst, durchaus auch mit Stolz, als „Rattler“ oder „Ratzen“ bezeichnen, wie es beispielsweise Gernot Zimmermann in seinem Buch „Ich war ein Reichenauer Rattler“ (2020) getan hat? Wie kam es dazu, dass im restlichen Innsbruck und seiner Umgebung vor allem mit Verachtung, ja teilweise sogar Furcht, aber auch immer mit einem Augenzwinkern von diesem Viertel gesprochen wird? Wie kam es dazu? Was sind die Hintergründe der zahlreichen Possen aus und über diese Gegend?
In dieser kleinen Reihe, sollen ebendiese Hintergründe, mit ein paar Anekdoten beleuchtet werden.

Nur wenige Jahre später war die Au- und Wiesenlandschaft im Osten Innsbrucks größtenteils zubetoniert. Der Bau und die Besiedelung der Reichenau waren systematisch geplant, sie entstand nicht aus sich selbst heraus, wie dies bei anderen Vierteln der Fall ist.
An dieser Stelle ist auf einen Beitrag zu verweisen, der diese Entstehung mit einer Luftaufnahme darstellt : In der Trabantenstadt – Innsbruck erinnert sich
Mit der Reichenau koexistierte damals noch die berüchtigte und mit zahlreichen Beiträgen bereits vielfach besungene Bocksiedlung. Sie stellt wohl einen maßgeblichen Faktor in der Entstehung des Rufes der Reichenau dar. Ihre letzten Hütten wurden am Anfang der 70er Jahre endgültig abgerissen und ihre Fläche sowie ihre Bewohner von der neuen Reichenau „absorbiert“.

Doch was geschah, dass aus diesem neuen Stadtteil, dieser Hoffnung der modernen und nachhaltigen Wohnraumschaffung, ein so verrufener Ort wurde?
Verfasser: Julian Rakob
Titelbild: Stadtarchiv Innsbruck, Ph-4183


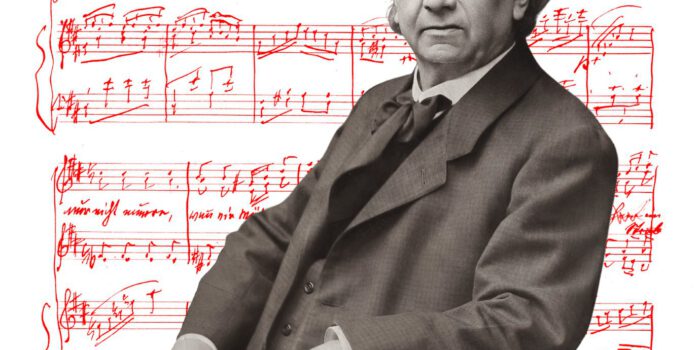

Die Frage, die der Autor des Beitrags aufwirft, muss zum Teil wohl psychologisch beantwortet werden: nur allzu gerne erheben sich Menschen über andere und blicken auf diese herab. Die „Alt-Eingesessenen“ hatten wohl Ängste und Unsicherheiten bezüglich der „Neu-Zugezogenen“ der Nachkriegszeit und der rasanten Veränderung des Stadtbilds dieser Zeit. Abwertung und Überlegenheitsgefühle sind dann die Mechanismen, mit denen psychologisch auf diese Unsicherheit reagiert wird. In vielen Städten gibt es Viertel, die diese „Sündenbock“-Rolle zugeschrieben bekommen. Wie gut, wenn das Stadtarchiv auch dazu beiträgt, solche Vorurteile aufzubrechen.