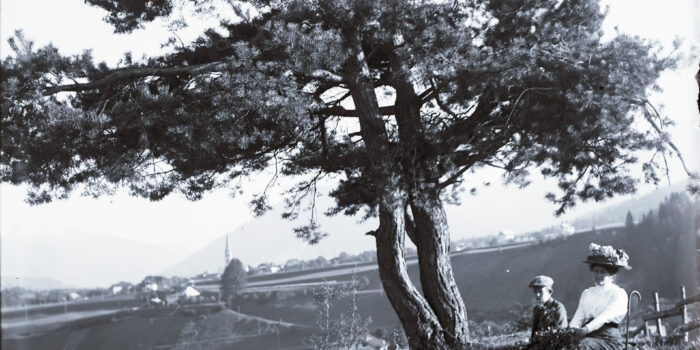Ein Heiliger der Extraklasse – der Hl. Johannes Nepomuk
Einer der wohl am häufigsten dargestellten Heiligen in unseren Breiten ist der Hl. Johannes (von) Nepomuk. Auch hier in Innsbruck erinnert ist er uns bereits des Öfteren begegnet (z.B. hier und hier)
Sein Leben sei hier nur in den kürzesten Zügen erzählt: Johannes stammte aus dem westböhmischen Pomuk (seit 1918 Nepomuk), seine Lebenszeit fällt in die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts. Im Jahr 1380 wurde er zum Priester geweiht. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität in Prag und setzte die Studien an der Universität in Padua fort, wo er 1387 das Doktorat des Kirchenrechts erlangte. Bereits seit 1369 war er im Umkreis des Gefolges des Erzbischofs von Prag tätig. Im Jahr 1389 ernannte ihn der Erzbischof von Prag, Johann von Jenstein, zu einem seiner Generalvikare. Durch dieses erzbischöfliche Vertretungsamt war Johannes unmittelbar in die machtpolitischen Streitigkeiten zwischen dem Prager Erzbischof und König Wenzel IV. involviert, bei denen es insbesondere um die Übertragung hoher kirchler Ämter und die Ernennung von Bischöfen ging. Wenzel versuchte zudem, den Machtbereich des Erzbistums Prag zu durch die Neuerrichtung eines westböhmischen Bistums Kladrau, zu verkleinern. In Kladrau bestand ein Benediktinerkloster, wo ein Günstling Wenzels als neuer Abt fungieren- und als erster Bischof des neuen Bistums eingesetzt werden sollte. Die Wahl, die am 7. März 1393 stattfand, brachte jedoch auf einen anderen Abt hervor – und Johannes von Pomuk bestätigte diese als gültig. Da Wenzel gerade nicht in Prag weilte, konnte er die Einspruchsfrist nicht einhalten.
Im weiteren Verlauf der Streitigkeiten wurden einige erzbischöfliche Beamte gefangen genommen und gefoltert – darunter auch Johannes von Pomuk, der schließlich in die Moldau gestürzt und ertränkt wurde. Sein Leichnam wurde in der Heilig-Kreuz-Kirche bestattet und später in den Veitsdom überführt.
Mit seinem Tod beginnt auch die Legendentstehung rund um den Heiligen. Etwa besagt die gängige Version der Martyriumsgeschichte, dass er nicht aufgrund machtpolitischer Zwistigkeiten in die Moldau gestoßen wurde, sondern weil er ein ihm anvertrautes Beichtgeheimnis von Wenzels Frau, die der Untreue verdächtigt wurde, nicht verraten wollte. Über seiner Leiche im Wasser sollen fünf Flammen erschienen sein, ebenso soll die Moldau ausgetrocknet sein. In der Ikonographie wird er meist mit einem Heiligenschein mit fünf Sternen dargestellt, jeder steht für einen Buchstaben des lateinischen Wortes tacui – „ich habe geschwiegen“. Als klerikales Attribut, um seinen kirchlichen Rang zu kennzeichnen, trägt er meist ein Birett und häufig halblange Gewandung (oft Mantel-ähnlich und halboffen, z.B. eine Almutie, aber da gibt es zu viele Verschiedene, um die alle aufzuzählen). Als Zeichen des erlittenen Martyriums hält er oft die Märyterpalme, teilweise auch ein Kreuz.
Im 18. Jahrhundert stieg seine Beliebtheit geradezu rasant an. Im katholischen südlichen deutschen Sprachraum und in Böhmen und Mähren fand und findet man Johannes Nepomuk heute noch meist als Brückenheiligen. Als Nothelfer gegen Wassergefahren und Schutzpatron für Reisende drängte er z.B. sogar den Heiligen Christophorus zeitweise zurück. Im Habsburgerreich des Barock könnte man ihn quasi als Staatsheiligen ansehen.
Auch in Innsbruck trifft man da und dort und überall auf Nepomücken, wenn man nur ein bissl die Augen aufhält beim Brückenüberqueren. Im Bild mein Lieblingsnepomuk bei der Brücke über den Höttinger Bach in der Daxgasse Richtung Alte Kirche.
(Stadtarchiv Innsbruck, Ph-6743)