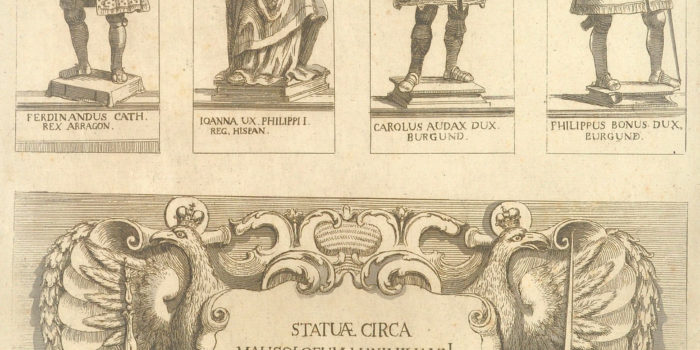Das Ahnenerbe (IV.)
Bereits im Juli 1941, kurz nach Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion, hatte der Stellvertretende Reichsgeschäftsführer des Ahnenerbes angeregt, die Organisation sollte sich auch weiter östlich wieder auf die Jagd nach Kunstschätzen machen. Gerechtfertigt wurde es sowohl mit der Suche nach Aktivitäten germanischer Stämme in diesem Gebiet, als auch mit dem Schutz der Artefakte vor den Kriegshandlungen. „Geschützt“ wurden sie natürlich, indem sie in Kisten gepackt und auf den Zug in Richtung Berlin gesetzt wurden. Sievers plante, auf der Krim eine Außenstelle des Ahnenerbes einzurichten, um dort Ausgrabungen nach gotischen Siedlungen durchführen zu können. Der sich für das NS-Regime nicht vorteilhaft entwickelnde Krieg beendete dieses Vorhaben jedoch frühzeitig. Nach der Vernichtung der 6. Armee in Stalingrad teilte Himmler seinen Untergebenen im Ahnenerbe mit, dass vorerst die Kriegsanstrengungen oberste Priorität hatten. Das bedeutete allerdings nicht, dass Himmler und andere führende Köpfe des NS-Regimes ihre Vorhaben für diese Gebiete aufgaben. Tatsächlich gab es wie in Teil II. erwähnt sogar Pläne, die Südtiroler Optanten auf der Krim anzusiedeln – denn schließlich hatte es dort mit den Goten bereits eine germanische Präsenz gegeben, so die Begründung.
Es war jedoch nicht der großangelegte Kunstraub, der mehrere Angehörige des Ahnenerbes nach dem Krieg vor Gericht brachte. Das wohl düsterste Kapitel der Geschichte der Organisation stellen die Menschenversuche dar, die unter seiner Ägide durchgeführt wurden. Eine eigene Abteilung innerhalb des Ahnenerbes, das Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung war zu diesem Zweck gegründet worden. Die Versuche begannen 1942, als der Mediziner Sigmund Rascher (1909–1945), der 1939 dem Ahnenerbe beigetreten war, in Dachau „Höhenversuche“ in einer Unterdruckkammer durchführte. Anlass dafür war die geplante Entwicklung von Jägern, die eine Höhe von 18.000 Metern erreichen sollten. Rascher verfolgte seine Experimente primär aufgrund seiner Ambitionen, Karriere bei Himmler zu machen, der persönlich daran interessier war. Deshalb war ihm vor allem daran gelegen, seinen eigenen „Enthusiasmus“ zu unterstreichen – wobei schlichter Sadismus wahrscheinlich eine nicht zu unterschätzende Rolle spielte. Seine Lebensgefährtin beschwerte sich in einem Brief an Himmler, dass seine Kollegen zu viel Skrupel an den Tag legten. Im Zuge seiner Versuche ermordete er über 80 Menschen – bei den Versuchen die sein Kollege Hans-Wolfgang Romberg (1911–1981) durchführte, starb kein einziger der Insassen (was natürlich nicht bedeutet, dass sie ethisch vertretbar waren, aber es zeigt wie weit Rascher selbst hinter den moralischen Standards seiner Mittäter zurückblieb). Weitere 90 wurden von ihm im Zuge von Unterkühlungsversuchen ermordet. Rascher wurde jedoch nicht im Zuge der Nürnberger Prozesse verurteilt, sondern von Himmler. Er und seine Gefährtin, Karoline Diehl, entpuppten sich nämlich als serielle Kindesentführer und Hauptverdächtige am Mord einer seiner Assistentinnen. Sie wurden beide kurz vor Kriegsende in verschiedenen Konzentrationslagern hingerichtet.
Wolfram Sievers war als Generalsekretär an vielen der Verbrechen beteiligt, insbesondere an der Straßburger Schädelsammlung. Zusammen mit August Hirt (1898–1945) hatte er den Mord an 112 jüdischen KZ-Insassen angeordnet, um ihre Skelette für „anthropologische Forschungen“ zu verwenden. Hirt erschoss sich noch 1945 selbst, Sievers wurde in Nürnberg zum Tode verurteilt und im Juni 1948 hingerichtet.
(Himmler in Innsbruck vor dem Westbahnhof, Signatur Ph-855_D)