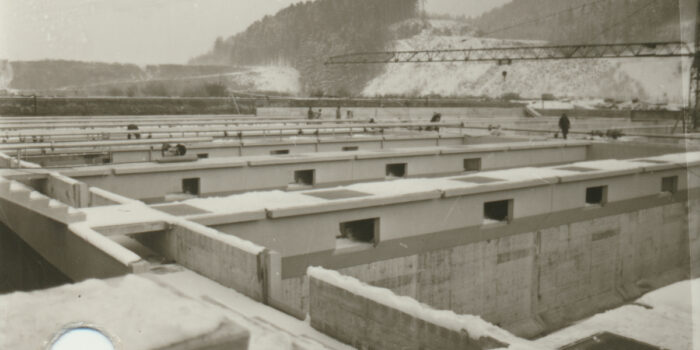T wie Telfer Schleicherlaufen: Das Tiroler Fasnachts-Lexikon (Teil VI)
„[…] wenn der Lateratråger schwingt und der Bär aus’n Meaderloch außa springt; nachher isch sie do, die schiane Fosnåchtzeit, die ins Telfer wohl am meist’n gfreit!“ (Quelle unbekannt)
Wir reisen für den heutigen Beitrag ins Tiroler Oberland. Alle fünf Jahre findet in der Marktgemeinde Telfs das sogenannte Telfer Schleicherlaufen statt, das seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der Ortskultur ist. Die ältesten Erwähnungen zur Fasnacht allgemein sind in Kopialbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts nachzulesen. Bei einem Kopialbuch handelt es sich um eine nachträglich angelegte Sammlung von Urkunden einzelner Bestände. Ein direkter Bezug zum närrischen Treiben in Telfs findet sich wiederum in einem Gerichtsakt vom 2. April 1612, wonach es im Zuge der Fasnacht vor Ort zu Raufereien gekommen sein soll:
[…] des Pflegers zu Herttenberg [bei Pfaffenhofen, Anm.] und des Gerichtschreibers daselbs ungebürlich Verhaltens halber, das nemblichen dieselben als Sy negstverschinen Fasnacht von irem Gerichtsherrn, alda neben andern Personen mer zu Gast geladen und beruefft worden in ernents Gerichtsherren Behausung in Eurem und anderer Personen mer beyseyn, Unhendl angefanngen, mit einander geraufft und geschlagen, […]. An Nicolaus Troyer/Zoller und Stadlmaister zu Telphs. (zit. nach Gapp, 1996, S. 152)
Von solchen Vorkommnissen im Zusammenhang mit dem Faschingstreiben ist in Tiroler Gerichtsakten immer wieder die Rede, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass die jeweiligen Obrigkeiten in regelmäßigen Abständen versuchten, die Fasnacht zu verbieten. Bis ins Jahr 1830 lässt sich das Telfer Faschingsbrauchtum nur über Gerichtsakten rekonstruieren, erst dann entsteht im Rahmen eines langen amtlichen Schriftverkehrs eine ausführliche Beschreibung des Schleicherlaufens, aus dem hervorgeht, dass die Kerngruppen des Umzugs – Schleicher, Bären, Laninger, usw. – bereits bestanden. Von wesentlicher Bedeutung für die Weiterentwicklung der Telfer Fasnacht war auch der sogenannte „Fasnachtserneuerer“ Josef Pöschl (1846-1906). Der Maler und Bildhauer war von 1889 bis 1891 Bürgermeister der Gemeinde und zudem der damalige Fasnachtsobmann. Er regte die Neugestaltung der Wagen und des Umzugs allgemein an. Über den Hut des Vorhupfers – der Anführer der Schleichergruppe – schrieb er beispielsweise: „[…] der Vorhupfer trägt den Hut mit der Alphütte darauf, dies darf nie verändert werden.“ (nachzulesen bei Gapp, 1996, S. 156).
Am Anfang der Telfer Fasnacht steht das Naz-Ausgraben, das nicht vor dem Dreikönigstag stattfinden darf. Der Naz ist die Verkörperung der Fasnacht und wird am Ende der Festlichkeiten in Begleitung eines Trauerzuges wieder beerdigt. Nach zahlreichen einleitenden Bräuchen, wie etwa dem Bäreneinfangen oder die Umzüge der Baumflechten und Moose, findet am Faschingssonntag das Schleicherlaufen statt. Der Umzug beginnt im Ortsteil Lumma und wird von der Gruppe der Herolde angeführt. Sie haben zuvor die Fasnacht vor dem Landhaus in Innsbruck verkündet und den Landeshauptmann zu den Feierlichkeiten geladen. Die Herolde sind zu Pferd unterwegs, dabei verliest der Obmann den aus dem Jahr 1925 stammenden Ladspruch. Hier ein Auszug
[…] Das Spiel allein macht den Komödianten wie’s Predigen den Predikanten. Wer besser die Maskera spielt, kommt weiter, der andere bleibt ein Heiter. So allein in tausend Gestalten kann sich das Leben entfalten. […] (Gapp, 1996, S. 164)
Nach den Herolden folgt die Musikkapelle Telfs, bevor im Anschluss die Gruppe der vier Jahreszeiten auftritt. Sie ist seit 1955 Teil des Umzugs und sticht vor allem mit ihrem bunten Gewand hervor. Jeweils drei Reiter auf Haflingerpferden symbolisieren den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter, was nicht zuletzt am Hutschmuck zu erkennen ist. Aber auch die Kleidung der Reiter und das Geschirr der Pferde ist den Jahreszeiten entsprechend geschmückt. Anschließend folgt der Auftritt der Wilden – düster dreinblickende Waldgestalten mit Holzlarven – und des Laternenträgers, der sich um die eigene Achse drehend und mit der Laterne schwingend an der Menge vorbeibewegt.
Die Schleicher sind jedoch der Höhepunkt des Umzugs. Sie tragen riesige Hüte, auf denen Miniaturbühnen zu sehen sind, die Themen aus den Bereichen des bäuerlichen Lebens oder Sinnbilder (Turm, Drache, Windmühle, u. a.) zeigen. Auf unserem heutigen Beitragsbild – ein Plakat aus dem Jahre 1950, das in Innsbruck zu Werbezwecken genutzt wurde – ist links zum Beispiel ein Schleicher mit einem Drachen als Kopfschmuck zu sehen. Darüber hinaus tragen die Schleicher prächtige farbige Gewänder sowie Drahtgeflecht-Larven. Die Figuren marschieren hintereinander und bilden an einzelnen Aufführungsplätzen einen Kroas und vollführen Ehrentänze. Das Highlight der Schleichertänze ist der sogenannte Doppler. Dabei tanzt ein Schleicher die doppelte Anzahl von Sprüngen, sodass er einmal dem Vordermann ins Angesicht sehen kann und dann wieder so dasteht wie zu Beginn des Tanzes. Dieses Schauspiel verlangt eine ausgezeichnete Kondition und ein gut koordiniertes Zusammenspiel mit dem Vordermann. Das Aufspringen der Schleicher muss so getaktet sein, dass die Schellen gleichzeitig anschlagen. Nach den Schleichern folgen die Gruppen der Bären und der „Exoten“, die Laninger, die Vogler sowie die Festwägen. Die Laninger bilden den eigentlichen Abschluss des traditionellen Teils der Telfer Fasnacht, treten aber noch vor den Wägen auf, da sie als Fußtruppe unterwegs sind. Sie führen unter anderem ein Stück auf, das in einem turbulenten Streit endet. Zwar erscheint ein „Polizist“, aber die Laninger halten zusammen und vertreiben den Ordnungshüter. Im Anschluss stimmen sie das Laningerlied – die „Hymne“ der Telfer Fasnacht – an.
(Foto: Stadtarchiv Innsbruck, Pt-1541)