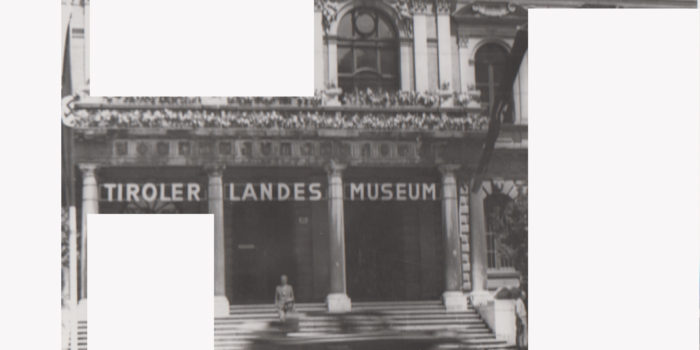Postkolonialismus im Kolonialismus
Viele der Kritiken, die wir heute von Autoren der Postkolonialen Theorie kennen, wurden bereits vorgebracht, als der Kolonialismus in voller Blüte stand. In der Habsburgermonarchie war man dabei in der angenehmen Position, dass man selbst keine Kolonien hatte, die einzigen Indigenen die man misshandeln konnte, waren einige Robben im Kaiser-Franz-Josef Land.
Ein Beispiel für diese Kritik finden wir in einem Artikel im Innsbrucker Tagblatt vom 7. Juli 1875: Der englische Opiumhandel. Er beginnt mit einem bissigen Kommentar zur der damals so oft angeprangerten Arroganz der Engländer:
Es ist ein hervorragender Charakterzug des englischen Volkes, dass es glaubt keine Nation der Erde stehe ihm an humaner Bildung und Ehrenhaftigkeit gleich; seiner Überzeugung nach kann Niemand in dem gleichem Grade, wie der Engländer, dasjenige sein, war er unter dem Worte „Gentleman“ versteht.
Dann folgte eine Kritik, die uns eben heute allzu vertraut erscheint: Dass die englische Lobpreisung des Freihandels die britische Regierung nicht daran hinderte, ihre Handelspolitik in den Kolonien je nach Bedarf flexibler zu führen. So waren verschiedene Monopole eine bedeutende Einnahmequelle der Kolonialregierungen. Doch unter ihnen war eines, das die anderen bei weitem in den Schatten stellte – das Opiummonopol in Britisch-Indien. Dieses sorgte für ein Fünftel (!) der Einnahmen dieser Kolonie. Zum Vergleich, Alkohol- und Tabaksteuer zusammen bringen der Republik Österreich heute knapp über 2% ihrer Einnahmen. Die Kolonialbehörden rechtfertigten sich damit, dass der Handel auch ohne sie stattfinden würde und dass er durch ihr Monopol begrenzt würde. Diese Behauptung wurde schon allein durch die Tatsache, dass der Export von Opium während ihrer Herrschaft von einigen hundert zu mehreren zehntausend Kisten pro Jahr anstieg, als kümmerliches Feigenblatt entlarvt. Ebenso waren die bereits erwähnten Beschwörungen des Freihandels geradezu unsinnig. Selbst wenn man von dem Monopol der East India Company absieht, durch welches von „Freihandel“ schon keine Rede sein konnte, war es natürlich völlig absurd, die Freihandelsdoktrin auf Rauschgifte anzuwenden. Bereits viele Zeitgenossen sahen den Opiumhandel als ein hochgradig unmoralisches Unterfangen und schenkten ihm durchaus Beachtung, wie man daran erkennen kann, dass er es selbst in Innsbruck auf die Titelseite der lokalen Zeitungen schaffte. Aber das Geld, welches durch den Drogenhandel in die Staatskasse gespült wurde, war ein (un-)ansehnlicher Anreiz, Argumente zu seiner Verteidigung zu finden. Wie Benjamin Franklin es so schön formulierte: „It is convenient a thing to be a reasonable creature, since it enables one to find or make a reason for everything one has a mind to do.“