Alt & ehrwürdig
Als älteste Schule Westösterreichs und eine der ältesten Schulen im deutschsprachigen Raum darf sich das Akademische Gymnasium in Innsbruck betiteln. Mit Gründungsdatum 12. Mai 1562 wurde es im Zuge der Gegenreformation als Lateinschule der Jesuiten eröffnet. Mit 71 Schülern, hauptsächlich adeliger Söhne, startete der Unterricht erstmals am 25. Juni desselben Jahres. An das Gründungsdatum 1562 erinnert heute noch ein Wappenstein an der Ecke Universitätstraße/Angerzellgasse. Allerdings war es gar nicht so einfach, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen: Vorerst fand der Unterricht in den Räumlichkeiten des späteren Volkskunstmuseums statt, die den Jesuiten vom Franziskanerorden zur Verfügung gestellt wurden. Allerdings eskalierte im Jahr 1575 ein Streit zwischen Franziskanern und Jesuiten und das Gebäude musste geräumt werden. Die Schüler wurden nun unter anderem in der heutigen theologischen Fakultät untergebracht, doch es herrschte eklatanter Platzmangel. Im Jahr 1599 mussten sogar zwei Klassen stehend unterrichtet werden.
Die Gebäudegeschichte bleibt spannend: Ein neues Schulhaus wurde im Jahr 1606 fertiggestellt. Dieses wurde jedoch bei einem Erdbeben beschädigt. 1724 zog die Schule deshalb in einen Neubau, von niemand geringerem als Georg Anton Gumpp errichtet: das heutige Gebäude der theologischen Fakultät. Hier war das Akademische Gymnasium bis 1868 beheimatet, dann musste es wieder in Räumlichkeiten des Volkskunstmuseums ziehen. Das heutige Schulgebäude wurde schließlich im Jahr 1909/10 am Gelände des ehemaligen botanischen Gartens des Jesuitenordens errichtet. Tatsächlich hörte der Platzmangel aber auch mit dem neuen Gebäude nicht wirklich auf: Vor allem in Kriegszeiten wurde es immer wieder eng. Erst mit Bau des Reithmanngymnasiums 1965 wurde die Situation entschärft.
Und noch etwas Anekdotenhaftes zum Abschluss: ursprünglich als Schule hauptsächlich für adelige Burschen begonnen, hat das AGI auch heute noch den Ruf einer „Eliteschule“ – sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. So ist das AGI mit dem Paulinum in Schwaz die einzige Schule in Tirol, wo man (noch) Alt-Griechisch als Fach wählen kann und damit die einzige in Innsbruck, wo man eine klassische humanistische Ausbildung erhalten kann. Auf der anderen Seite ist – wohl auch bedingt durch die Nähe zum Gymnasium Sillgasse, ein kleiner „Konkurrenzkampf“ zwischen den Schulen entstanden: die „AGI-ler“ (zu denen auch ich mich zählen durfte) wurden vor allem von den benachbarten Sillgasslern ganz gerne als die „Reichen und Schönen“ bzw. die „Schnösel“, bezeichnet („AGI“ selbst mauserte sich wohl zum bezeichnenden Ausdruck). Welche Attribute wir wiederum den Sillgasslern zuschrieben, wird an dieser Stelle verschwiegen… 🙂
(Foto: Friedl Murauer, Stadtarchiv Innsbruck, Ph-9250)


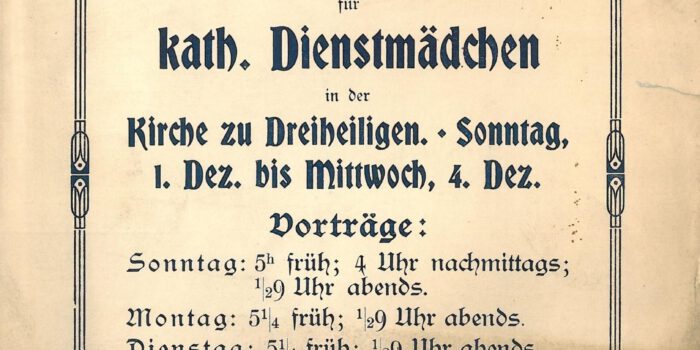


„Haus der Güte und Barmherzigkeit“ nannte der legendäre, und manchmal weder gütige noch barmherzige Direktor Auer seine Schule.
Im Jahr 1958 ins Gymnasium eingetreten, erlebte ich die Schule anfangs noch im Schichtbetrieb. Wir mußten uns das Gebäude mit dem 2. Realgymnasium teilen. Das 1. Realgymnasium war Teil des Hauses Angerzellgasse. Die Klassen der humanistischen Bildungsschicht hatten ein a als Zusatz, die Realgymnasiasten b und c.
Der Schichtbetrieb war wochenweise abwechselnd vormittags von 7:55 – 13:00 oder nachmittags 13:30 – 18:15 organisiert. Da sich die volle Unterrichtszeit nicht ausgegangen wäre, ehe die Nachmittagsklassen einzogen, dauerte eine Unterrichtsstunde nur 50 Minuten. Den Samstagvormittag teilten wir uns, die Nachmittagsschicht der Woche hatte dann erst um dreiviertel Zwei frei, Ich erinnere mich gut an die Heimfahrt mit dem Fahrrad durch die seinerzeit geisterhaft leeren Straßen.
Der größere Zeitmaßstab war die Dreiteilung des Schuljahres in Trimester mit zwei Zwischenzeugnissen, eine schon lange nicht mehr geübte Praxis. Es gab zwei Schularbeiten pro Trimester, Latein, Griechisch (ab der 3. Klasse), Englisch (ab der 5. Klasse), Deutsch und Mathematik (damals Mathés, nicht Máthe), deren Benotung mit wenigen Ausnahmen den Gesamtlernerfolg bestimmten. In den „Nebenfächern“ pflegte man nicht durchzufallen. Mit einem „Fleck“ im Jahreszeugnis gabs im Herbst gnadenhalber eine Wiederholungsprüfung, die einem natürlich die Ferien verpatzte, ab 2 Fünfern blieb nur mehr die Wiederholung der Klasse. Manche schafften – vor allem in der 4. Klasse, als das Pensum für Faule einfach zu groß geworden ist – 4 Fünfer und, endlich der Knopf aufgegangen, maturierten dann trotzdem noch.
Das humanistische Gymnasium war im Übrigen nicht „elitär“. Es entsprach mit seinem Lehrplan lediglich den Forderungen der Universität, Medizin nur mit Kenntnissen der Altgriechischen Sprache studieren zu dürfen, Latein sowieso. Das hatte zur Folge, daß auch Mädchen zugelassen wurden, wenn ihre Zahl auch gering war.
Weiters gab es noch für alle Mittelschulen eine Aufnahmsprüfung. Ich habe den Zettel mit den Anforderungen für die selbe noch in meinem Besitz. Eigentlich mußte man nur können, was man in der Volksschule gelernt haben sollte. Also fernab jeglicher Auslese oder Schikane. Sie bewahrte nur Unbegabte vor einem elenden Schicksal des Versagens, war aber trotzdem noch lange keine Garantie für die Matura.
Noch ein paar Worte zum Bauwerk selber: Die ersten Klassen und zweiten waren im Parterre, in der Oberstufe waren wir dann im obersten Stockwerk angelangt, ein echter Aufstieg also. Im obersten Stock war hinter den Fenstern des schön geschwungenen Mittelstücks das Musikzimmer, die großen Fenster rechts davon gehörten zum riesigen Zeichensaal mit seinen ergometrischen Ministühlen, im folgenden Erkerzimmer hauste der Professor Brugger mit seiner Leihbücherei, wo bedürftige Schüler die nicht billigen Lehrbücher entlehnen konnten. Viele verkauften ihre Bücher an die untere Klasse weiter, ebenfalls eine Möglichkeit zu sparen. So gab es ein sündteures Geographiebuch von Seydlitz, welches niemals verwendet wurde, aber jedesmal in die Schule zum Unterricht mitgeschleppt werden mußte…man denke sich dabei was man will. Jedenfalls konnte es drei- viermal als neuwertig verscherbelt werden.
Ein Wort noch zur „Großen“, d.h. viertelstündigen Pause nach der dritten Stunde: Es wurde Wert auf Bewegung gelegt, wenn auch gesittet nach dem Vorbild griechischer Philosophen in Zweierreihe wandelnd. Im Sommer im Garten, sonst in den langen Gängen. Dazu konnte man sich beim Schulwart eine Jause kaufen, wenn man keine dabei hatte.
Aber bevor aus dem Kommentar ein Buch wird, breche ich hier ab.
Lieber Herr Hirsch,
immer schön, ein bisschen aus der Geschichte der eigenen Schule zu hören und in Erinnerungen zu schwelgen. Zu meiner Zeit (nach dem Umbau und ein paar Jahren in den Containern bei der Technik) war der Musikunterricht dann ganz unten neben der neuen Aula untergebracht und im obersten Stock die Zeichensäle und Computerräume. Die Bibliothek ist ins Erdgeschoß gewandert.
Ob nun „elitär“ oder nicht (deshalb „Eliteschule“ auch unter „Anekdotenhaftes“ aufgeführt) – den Ruf als solche hatten wir bei den gleichaltrigen Innsbrucker SchülerInnen zu meiner Zeit allemal…
Das Bild aus der Jetzt-Zeit ist leider abgeschnitten. Hier die Totale: https://postimg.cc/YhCK46nM
Einen schönen Sonntag, Herr Hirsch! Ich fühle mich jetzt um Jahrzehnte jünger, nachdem endlich ein Kommentar zum Gymnasium Angerzellgasse aufgetaucht ist und ich diesen gelesen habe. Dazu noch in dieser meisterlichen Art! Danke Herr Hirsch! Vielleicht kommen noch ein paar weitere Einträge von anderen, möglicherweise auch von mir (ich muss nur jetzt leider schnell weg) – Sie könnten dann wirklich ein Buch schreiben!
Das Falsche erwischt??
Für Herrn Hirsch:
Gehört zu Ihrem Beitrag von heute 9:52 (Link für Foto!??)
Den legendären Direktor Auer habe ich auch noch erlebt. Er hat den Geist dieser Schule sehr gut verkörpert. Ich war ab Herbst 1972 für fünf Jahre dort (Ehrenrunde in der Dritten und Wechsel ins Borg nach der Vierten). Direktor Auer fand wirklich die Zeit am Beginn des Schultages im Eingangsbereich zu stehen und erstens: Schüler mit zu langen Haaren zwanzig Schillinge in die Hand zu drücken und zum Frisör zu schicken und zweitens: Zuspätkommende zu maßregeln.
An Prof. Rutzersdorfer, Schromm und Loinger dürften sich auch ältere Semester erinnern. Legendär und gefürchtet zu meiner Zeit waren u.A. Zecha (er traf einen auch noch in der letzten Bank vom Lehrerpult mit seinem schweren Schlüsselbund genau am Kopf) und Schoißwohl (Gagabene-Zitat: Ritzenfeld, ich dachte zumindest du würdest dich über den Rest des Pöbels erheben). Da gäbe es jetzt noch Einige – aber wir wollen ja keine Bücher schreiben.
Viele ehemalige Mitschüler*Innen haben wirklich schöne berufliche Ziele erreicht in ihrem Leben. Ich, obwohl ich dann auch im Borg nicht maturiert habe, bin trotz aller Schwierigkeiten die ich damals erlebt habe (und sicher auch den Lehrer*innen bereitete), mein ganzes Leben dankbar, dass ich dieses breite, solide akademische Grundwissen erwerben durfte.
Ich besuchte im Schuljahr 1954-55 die 1a des Gymnasiums. Die 2. Klasse war ich wie.der in „meiner“ Müllerschule, da die LBA wieder in die Fallmerayerstrasse zurück kehrte. Da ich in der Stafflerstrasse wohnte, war natürlich die Müllerstrasse näher als die Angerzellgasse.
Nun zurück zur 1a. Mein Klassenvorstand war Prof. Friedrich Fetz, mit dem ich dann später auf der Sport Uni viel zu tun hatte. Aber in die Parallelklassen gingen auch bekannte Persönlichkeiten. Allen voran unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen und in eine andere Klasse ging der bekannte Sportchef des ORF Manfred Gabrielli. Leider viel zu früh gestorben.
W en man die Schule betrat, war das schon ein sehr humanistische Gefühl.
NICHTS in meiner Jugend hat so viele Erinnerungen hinterlassen wie das Akademische Gymnasium ab 1964. Der Hofrat Auer („Freund, geh zum Friseur !“), all die ehrwürdigen Professoren wie Gerber (Mathés – ein wunderbarer Mensch), Hohlbrugger (Latein – „Hast wieder nicht studiert, Bursche! Jeder will studieren und keiner will studieren.“ Wobei er st wirklich als s-t und nicht tirolerisch als sch-t ausgesprochen hat), Murr (Griechisch – rief immer triumphierend die Namen der von ihm Auserkorenen zur Prüfung), Schrom (der mich mit seiner außerordentlichen Gabe als Pädagoge für´s Leben geprägt hat), Klell (ein echter Künstler), Gerhold („Krautwachter ! Stehplatz bis Weihnachten !“) usw. usw., also darüber könnte ich echt auch einen ganzen Wälzer schreiben. Alles in allem hat mir diese Schule unschätzbare Werte für´s Leben mitgegeben, obwohl ich Rolling Stones Fan war (und immer noch bin).
Dann die „Erholungsmärsche“ im Hof in der großen Pause – alle geordnet schön im Kreis und immer in Bewegung – und eng damit verbunden natürlich auch die Zeit in der MK mit dem legendären Pater Kripp.
Vor einigen Jahren war Tag der offenen Tür im Gymnasium. Ich ging rein und stellte mich im 1. Halbstock, unter dem Kreuz auf genau den Platz, wo der Hofrat Auer immer mit seinem Bambusstöckchen gestanden ist und die Haare der Schüler kontrolliert hat (1 cm über den Ohren war so ziemlich die tolerierte Obergrenze – also nix Beatles oder Stones !). Dann sagte ich ganz laut: „Freund, geh zum Friseur !“ Zum Glück war niemand in der Nähe. Die hätten wohl gedacht „Na der hat oan schianen Schuß“ .
Vielleicht schreib i meine zahlreichen Erinnerungen doch noch einmal auf, Zeit genug hätt ich jetzt ja.
Nein, ich hale die Klappe.
Aber Ergänzungen zu Prof. Murr, der ständig ein äh in die Rede einflocht, zu Schrom mit seinem „Heuwägelchen!“ (tätschelte mit dieser Phrase die Hand eines nervösen Prüflings),konnte aber auch recht zynisch sein, und zum Hohlbrugger, den ich nur aus der Supplierstunde kannte.
Hohlbrugger begann mit Ciceros Catilinarede, die er aber eher lallte als stilecht vortrug: „Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?“ klang etwa so wie „Kwoo uskwww tnmm abuthmmnne,Catilina pazienzza nossa?“ dabei ging er durch die Bankreihen und Peng! haute er nach nossa den Cicero dem nächstbesten Schüler auf den Kopf, der gerade neben ihm saß. „Was heißt das, S…theiner? Zu dumm dafür, gell.“. Hohlbrugger hatte einmal einen dicken Lottogewinn gemacht, war immer gut gekleidet und fuhr einen dicken Opel Kapitän, wenn nicht gar einen Amischlitten. Er rauchte, trank Whiskey und trieb sich in Bridgeclubs herum und war unter den Kollegen sicher ein enfant terrible. Nur Klell machte ihm diesen Titel streitig. Hohlbrugger kam mir immer vor wie die Volksausgabe von Hans Albers.
Lustig gemeinte Gewalt war in kleinen Dosen durchaus üblich, der Deutschlehrer Vinatzer bewarf Schüler mit seinem Schlüsselbund, und der Religionslehrer Bodner teilte robuste Kopfnüsse aus. Alles überlebt.
Sehr beliebt war der Naturgeschichte und Chemielehrer Tamerl, damals der mit Abstand jüngste Lehrer. Er sprach in einem Telegrammstil: Mann gewesen, umgefallen – hin! Herzschlag.
Genug.
Der Tamerl, ja auch ein echtes Original.
Wir hatten ihn in Physik. Einmal gingen wir in den Physiksaal. Dort mussten wir die Rollos herunterlassen, der Tamerl stellte einen Filmprojektor auf. Der Raum war komplett finster. Dann schaltete er den Projektor ein, der Lichtstrahl bahnte sich seinen Weg durch die Finsternis. Dann zündete er sich eine Zigarette an, rauchte diese genüsslich und blies den Rauch ins Licht. Keine Ahnung mehr, wie der physikalische Fachausdruck dafür heißt. Danach Rollos rauf, Projektor aus und Tamerls Erklärung (werd ich nie vergessen): „Jetz wissts wieso i Physiklehrer woarn bin: da kann ma während der Arbeit zwischendurch amol oane raaachn.“ Mit Auf- und Abbau hat des Ganze a volle Unterrichtsstunde gedauert. Echt genial, der Dieter Tamerl !!!
Tamerl wurde übrigens 88, er starb im Jahr 2019. Umgefallen, hin.
Schade, war a total lässiger Typ, habe ihn geliebt.
Ja ja, der Hohli, der „normannische Kleiderschrank“ (neben Curd Jürgens). Einmal hatten 2 Mitschüler die Idee, ein Sackl voller Maikäfer vor der Lateinstunde im Papierkorb zu versenken. Während des Unterrichts kamen die Viecherl dann heraus und schwirrten munter durch die Klasse. Aber – wie´s der Teufel haben wollte – eines landete punktgenau auf Hohlis Kopf. Mit lässiger Geste wischte er das Käferlein herunter, was zur Folge hatte, dass seine Haare wie das Horn bei einem Nashorn kerzengerade in die Luft standen. Da konnte die Klasse das Lachen nicht mehr halten. Nachdem die Übeltäter nicht zu ermitteln waren, mußte die ganze Klasse zur Strafe ein gut Teil der „Vier Weltalter“ aus Ovids Metamorphosen (in diesem Fall Buch I, Verse 89 – 140), die wir gerade lasen, auswendig lernen. Hängengeblieben ist bei mir nur mehr Vers 89 „Aurea prima sata est aetas quae vindice nullo“. Vielleicht, weil ich bei weitem nicht alles Aufgegebene auswendig lernte und lieber einen Fleck in Kauf nahm (von dem ich aber mit viel Glück verschont geblieben bin).
Ja und der Klell, wohl das größte Original der ganzen Schule. Er ezählte uns alle möglichen Gschichtln, z.B. wie er früher Büffeljäger in Nordamerika gewesen war und die Büffel mit bloßer Kraft erlegte, indem er sie bei den Hörnern packte und zu Boden zwang. Außerdem erklärte er uns den unschätzbaren Vorteil eines Künstlers, nämlich dass man „immer genug naggate Weiber“ zur Verfügung habe. Das „naggate Weiber“ wurde dann bei uns zum geflügelten Wort, vor allem weil er´s immer wieder daherbrachte. Vor ein paar Jahren konnte ich bei Amazon gerade noch einen Bildband von ihm ergattern (gebraucht, aber in Bestzustand), den ich hoch in Ehren halte.
Tja 1000 Erinnerungen und mehr…
Lieber Thomas,
das sind schöne Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit und an die die Maikäfer-Aktion mit Hohli kann ich mich auch gut erinnern und für Klell’s naggate Weiber gilt das gleiche.
Hallo Markus, so schön, nach dieser langen Zeit von dir zu hören, echt bärig! Kann mich noch so gut an dich erinnern, wie auch an so manche andere Schulfreunde. Ja, war ne geile Zeit. Wenn ich manchmal am Akademischen vorbeispaziere, ist das heute noch sehr emotional für mich…
Vor kurzem bin ich wieder beim Gymnasium vorbeigestreift, seltsames Gefühl…
Dachte, der Hofrat Auer würde jeden Moment herauskommen und mich zum Friseur schicken (dabei bin ich doch immer noch Rolling Stones Fan – mittlerweile 55 Jahre)…
Herr Prof. Mumelter hat in https://innsbruck-erinnert.at/eine-pionierin/comment-page-1/#comment-46217 die Frage an mich gestellt „Sehr interessieren würde mich, ob Sie etwas über den noch viel schlimmeren Lehrer am Haus Alois Moritz wissen.“
Ich hatte ihn nie im Unterricht. Er war irgendwie aus der Zeit gefallen, mit Mittelscheitel und kreisrunden Brillengläsern, etwas schmuddelig, fast edelversandelt. In der Pause geriet einmal ein Mitschülerund Moritz aneinander, Dr. Moritz drohte schwerste Konsequenzen an und der Mitschüler vertraute sich ganz verdattert unserem Klassenvorstand an. Der winkte nur lächelnd ab „Ah sooo, der Moritz“. Ich glaub, er war vom Lehrkörper völlig isoliert. Erinnern kann ich mich auch an eine Moritz’sche Klassenbucheintragung, die im ganzen Gymnasium die Runde machte (heute: „viral ging“): „Pfauser sagt Bandlwurm und setzt sich auf den Papierkorb!“. Dr. Moritz war im Alter dann ein fast schon pathologischer Querkopf, der vom ihn ernährenden Staat nichts mehr wissen wollte und versucht hat, die Pension zurückzuschicken. Fama est. Cave, fama est.
Vielleicht erwähne ich auch meine jetzige Sicht des aus der Schülerperspektive ganz anders beleuchteten Lehrkörper. Auch von denen ging nicht jeder gerne arbeiten, es gab Zirkel und Klüngel. eine nicht unbeträchtliche Zahl war wohl vom Krieg traumatisiert, in einigen Fällen (Lichtenegger, Rutzersdorfer, Schrom, Vinatzer, Franz) kriegsversehrt nicht mehr vollständig im Besitz ihrer Glieder, war auch nicht lustig. Manche gingen wie Kollege Moritz vüllig verbittert in Pension, ließen sich bei den Pensionistenrunden der Zirkel und Klüngel nie mehr sehen.
An manche erinnere ich mich mit einem Lächeln, manche waren halt Kretzn. Gott Kupfer blieb aber eine Romanfigur.
Soll ich jetzt als Abgänger dieser Anstalt auch noch was beitragen?
Immerhin bin ich aus der nächsten Generation (maturiert 1986 unter dem Auer-Nachfolger Dir. Rief), habe jedoch in der Unterstufe ein paar von den alten Pädagogen in ihren letzten Amtstagen noch erlebt und mir sind sind sie zwar durchhaus freundlich, auch nachsichtig, bisweilen schrullig aber meist unfähig zu ihrer Aufgabe als Lehrer in Erinnerung. Frei nach dem Couplet „Gleant hamma nix, aba san doch arrogant“ (Das Hausherrensöhnchen, H. Qualtinger). Da das Zeichnen und Malen mir damals schon großes Vergnügen bereitet hat, waren die Zeichenstunden beim Klell mit seinen oft abgründigen Geschichten natürlich meine wöchentlichen Highlights, auch dann, wenn er den Unterricht wegen 42 Grad im Schatten, wie er konstatiert hat, ausfallen ließ und uns heimschickte. Ihn selbst fand man dann später im Hofgartencafe sitzen …