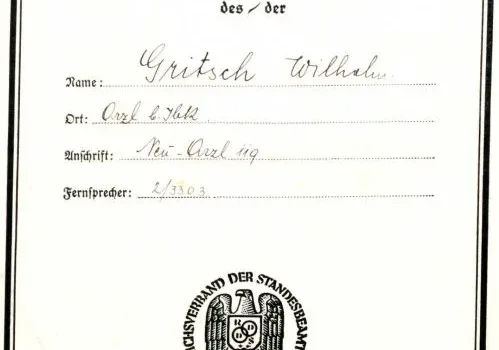Auf der Höttinger Alm… (2)
Die Almen um Innsbruck (und wahrscheinlich generell in Tirol) spielen meist sowohl eine landwirtschaftliche, als auch eine touristische Rolle, wobei die Gewichtung von Fall zu Fall unterschiedlich ist. In und um Innsbruck wird wohl das Geschäft als (Ausflugs)Gasthof weitaus einträglicher als die Almwirtschaft sein. Das trifft auch auf die Höttinger Alm zu, und das bereits mit Tradition.
Wilhelm Eppacher schreibt im Amtsblatt 1955, dass die Höttinger Alm „von den Bewohnern der nahegelegenen Landeshauptstadt von Tirol mit Vorliebe besucht, allmählich einen liedumrauschten und sagenumwobenen Namen erhielt. […] Der Alpenpächter, der aus der Reihe der Interessentenschaft kam, hatte für den Almbetrieb zu sorgen und auch die Gästebewirtung zu führen, die später durch die Verleihung der Gastwirtskonzession hinzukam. Aus mehrfachen Pressenotizen aus früherer Zeit geht hervor, daß jedoch die Touristen, die über den Frau-Hitt-Sattel in das Samertal wollten oder von dort herüberkamen, für die Bewirtung und insbesondere für die Unterbringung nicht viel Lob übrig hatten.„
Leider bleibt Eppacher recht vage, auf welche „frühere Zeit“ er sich dabei bezieht. Es wäre spannend, sich auf eine Spurensuche zu begeben, ab wann und wie sich die „touristische“ Bedeutung der Höttinger Alm entwickelte. In Beda Webers „Handbuch für Reisende in Tirol“ (2. Aufl., 1853) werden beispielsweise das Höttinger Bild, sowie die Frau Hitt und andere Berggipfel genannt, nicht aber die Alm (S. 65).
Die erste klar touristische Nennung, die ich mit „Höttinger Alm“ auf anno finden konnte, datiert erst aus dem Jahr 1878, als ein Geistlicher einen ironischen „Vorschlag zur Güte“ machte: „Eine chinesische Mauer rings um die Höttinger Alm wäre wahrlich kein Luxus„, meinte er. Denn „die menschenfreundlichen Sachwalter im genannten Gebiete wären dann der Mühe enthoben, die zudringlichen Touristen abweisen zu müssen. Ein Besuch der Höttinger Alm ist nämlich in neuester Zeit ein wenigstens undankbares, wenn nicht ganz undurchführbares Unternehmen.“ (IN, 14. 06.1878) Womöglich ist dies eine der Stimmen, auf die Eppacher anspielt? In jedem Fall ist damit belegt, dass sich die Höttinger Alm in den 1870er-Jahren bei Wanderern bereits einiger Beliebtheit erfreute.
Im Gegensatz zum Geistlichen hatte ein anderer (mutmaßlich Wiener) Besucher in etwa zur selben Zeit ein sehr positives Erlebnis, über das er elf Jahre später, im Jahr 1886 berichtete. Vom Hirten im Inneren bewirtet, beschreibt der Gast den Schmuck und verklärt dabei die Tiroler Werte für „Gott, Kaiser und Vaterland“:
„Neben dem Tische war an der Wand ein Altar aufgerichtet; es waren lauter kleine Heiligenbildchen in Form einer Monstranz zusammengesetzt. Fast in der Mitte waren die Bilder der Mutter Gottes und des Landespatrones, des heiligen Joseph. Ich sage „fast“ in der Mitte; denn in der eigentlichen Mitte selber war das Bild Seiner Majestät, unseres gnädigsten Kaisers Franz Josef, vom Tiroler kurzweg „Koaserbild“ genannt.— Auf die Frage, warum er gerade dieses Bild dorthin gegeben, gab der Hirte treuherzig zur Antwort: „Ja sehsn’s, Herr! weil ich oft wochenlang in keine Kirche komm‘, so halte ich meine Andacht zu Morgens und zu Abends da vor meinem Altar. Und wenn ich alle Heiligen abgebettelt hab‘, komm‘ ich zum Herzen Jesu, und sag‘ ihm, er soll mich auf der Alm halt nicht vergessen. Und zuletzt empfehle ich dem heil. Josef und der Mutter Gottes und dem Herzen Jesu unsern Kaiser an, daß sie ihn schützen mögen. Er braucht’s halt gar so viel, kann’s alloan fast nit mehr damach’n.“ (Salzburger Kirchenblatt, 18.11.1886)
Kaiser Franz Joseph „damachte“ es ab Erscheinen des Artikels noch ziemlich genau drei Jahrzehnte lang. Das heutige Titelbild dürfte wohl aus seinen letzten Regierungsjahren stammen. Von den erwähnten Bildern ist in der Gaststube nichts zu sehen, dafür glänzt sie überraschenderweise mit dem Luxus eines Grammophons. Und die (leider nicht entzifferbaren) Hinweisschilder außen unter dem Dach legen nahe, dass das Verhältnis zwischen Wirt und Gast auch damals kein gänzlich ungetrübtes war.
(Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck, Ph-31237)